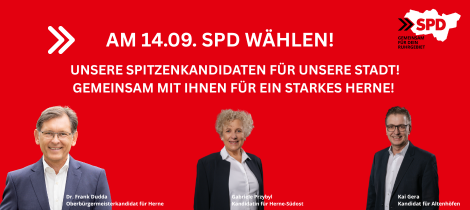Skurrile Objekte in neuer Ausstellung ab 3. Oktober im LWL-Museum für Archäologie und Kultur
Vom Natternbaum bis hin zum „ungemütlichen“ Besteck
Ebenso kurios wie die eine oder andere exotische Tischsitte sind die skurrilen Gegenstände, welche im Laufe der Kulturgeschichte auf den Eßtisch gekommen sind. Wer weiß schon, was ein Natternbaum ist, hat vor einem dampfenden Schweinskopf aus Porzellan gesessen oder versucht, mit einer gelenkigen Gabel zu essen?
Was diese Gegenstände über Essgewohnheiten erzählen, erfahren Besuchende ab dem 3. Oktober 2025 im Museum für Archäologie und Kultur in Herne: „Mahlzeit! Wie Essen uns verbindet“ heißt die neue Ausstellung.
Natternbaum
Gäste genießen traditionsgemäß in vielen Kulturen der Weltgeschichte einen besonderen Schutz, aber nicht immer halten sich Gastgeber:innen daran. So erhofften sich Teilnehmende eines mittelalterlichen Gastmahls durch besondere Objekte Schutz vor giftigen Substanzen. Dr. Matthias Bensch, Kurator der neuen Sonderausstellung: „Bis ins 17. Jahrhundert glaubten Menschen, dass z. B. Drachenzungen, Einhörner oder Bezoare - das sind Magensteine, also Verklumpungen z.B. aus verdautem Tierfell - durch Kontakt mit Giften oder auch nur die Nähe zu Giften diese offenlegen, indem sie ihre Farbe ändern oder Feuchtigkeit absondern.“
Der Natternbaum, eines der skurrilsten Exponate der Sonderausstellung „Mahlzeit!“ im Museum des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), stammt aus dem Besitz des Kurfürsten August von Sachsen (1526-1586) und hatte ebendiese Funktion. Bensch: „Auf einer Tafel sollten Natternbäume Gifte anzeigen. An Ästen unseres Ausstellungstückes hängen vermeintliche Natternzungen, die eigentlich Zahn-Fossilien von Haien sind. Hinter der Marienfigur, die auf dem Baum sitzt, befindet sich ein besonders großer Zahn, wahrscheinlich eines Megalodons, einer vor Millionen Jahren ausgestorbenen Hai-Art.“
Glasphallus
Nicht weniger kurios als dieser Aberglaube des Mittelalters bzw. der Frühen Neuzeit dürfte Besuchenden der Sonderausstellung „Mahlzeit!“ wohl die Tradition der Scherzgefäße erscheinen. Für Schmunzeln sorgte nicht erst bei seiner Entdeckung ein Glasphallus aus dem 16./ 17. Jahrhundert, den Archäolog:innen im Damenstift Herford in einer Kloake ausgegraben haben, die an die Gemächer der Äbtissin grenzte. Dr. Susanne Jülich, stellvertretende Museumsleiterin: „Das zum Teil nur 1,2 mm dünne Glas ist erstaunlich naturalistisch ausgearbeitet. Das Trinkgefäß galt als Symbol für Männlichkeit, Aggressivität und Fruchtbarkeit. In der Hand der Äbtissin dürfte es auch als Statement zu verstehen gewesen sein: Ich bin mächtig genug, mir diese Attribute anzueignen und mit Tabus zu brechen.“
Schaugericht
Aber nicht nur Trinkgefäße, auch Geschirr weist im Laufe der Kulturgeschichte häufig über seine Funktion hinaus, so ein Eberkopf aus Porzellan. Bensch: „Der Blick starr, das Maul aufgerissen, aus den Nüstern strömt Dampf - was klingt wie eine Szene aus einem Horrorfilm ist nur ein harmloser Gegenstand höfischer Tischkultur des 18. Jahrhunderts.“ In der tierischen Terrine seien feinen Leuten Speisen serviert worden, wohl vor allem Wildgerichte, so Bensch. Der obere Teil der Terrine - also des Kopfes - ist abnehmbar. „Es ist ein sogenanntes Schaugericht. Das sind sehr naturalistische Nachbildungen von essbaren Objekten in nicht essbaren Materialien. Solche Gegenstände sollten die Gäste täuschen und erheitern.“
„The Uncomfortable“
Überhaupt spielt Humor eine bedeutende Rolle bei der Sonderausstellung „Mahlzeit!". Besteck und Geschirr haben sich über Jahrhunderte entwickelt, manchmal um Essen komfortabler zu machen, manchmal aber auch zum Gegenteil. Katerina Kamprani z. B., deren Exponate ebenfalls ab dem 3. Oktober in Herne zu sehen sind, dreht den Spieß um. Ihre Serie "The Uncomfortable“ (zu deutsch das Unbequeme) zeigt absurde Objekte: zwei an den Henkeln verbundene Tassen, unbenutzbare Gläser oder Besteck mit Ketten, mit denen niemand essen kann. Statt Funktion steht hier Frustration im Mittelpunkt. Bensch: „Mit Humor entlarvt Kamprani, wie sehr wir uns auf durchdachtes Design verlassen und wie hilflos wir ohne es sind.“ Ein Hinweis auf die Selbstverständlichkeit des Alltags, mit denen das LWL-Museum den aktuellen Umgang mit Esskultur zeigen will.
Hintergrund zur Sonderausstellung „Mahlzeit! Wie Essen uns verbindet“ vom 3.10.2025 bis 13.9.2026 im LWL-Museum für Archäologie und Kultur in Herne
Gemeinsames Essen ist weit mehr als nur Nahrungsaufnahme. Ob beim königlichen Bankett, der einfachen Bauernmahlzeit, dem familiären Abendessen oder der gemeinsamen Mittagspause - überall offenbaren sich Fragen: Wer sitzt wo? Wer bekommt das beste Stück? Welche Rituale bestimmen das gemeinsame Mahl? Und was verrät das alles über Macht, Zugehörigkeit, gesellschaftlichen Wandel und vor allem Kultur?
Von opulenten Festtafeln und rituellen Speisungen bis hin zu den Herausforderungen der Gegenwart - schnelle Snacks, digitale Ablenkung und der scheinbare Verlust gemeinsamer Rituale - zeigt die neue Sonderausstellung „Mahlzeit!“, wie Essen seit Jahrtausenden als sozialer Klebstoff funktioniert.