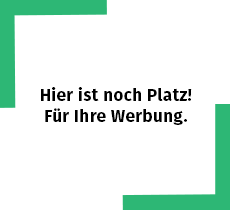Mit einem überragenden Albrecht Schuch
Neu im Kino: Lieber Thomas
DDR, 1955. Die idealistische Aufbaugeneration, zu der auch Horst Brasch (Jörg Schüttauf) als stellv. Kulturminister gehört, ist optimistisch, den Wettkampf der Systeme gegen das kapitalistische Westdeutschland zu gewinnen. Eben noch hat es seinem kleinen Sohn Thomas (Claudio Magno) gefallen, im Fond der Staatskarosse sowjetischer Bauart durch die Hauptstadt kutschiert zu werden, da soll Papas Ältester (nun Albrecht Schuch) in der Kasernenhof-Atmosphäre eines Militärinstituts auf Linie gebracht werden. Doch statt zu exerzieren in dieser geradezu preußischen Kadettenanstalt, liegt er lieber träumend im Gras, erinnert sich an den österreichischen Klang der Stimme seiner Mutter, die ihm Märchen vorliest.
Ost-Berlin, 1966. Die „Neue Zeit“ ist nur der Titel einer Blockpartei-Zeitung, in Wahrheit hat sich die DDR mit dem antifaschistischen Schutzwall selbst eingemauert. Thomas kann auf der Babelsberger Filmuniversität HFF nicht nur frühe Defa-Streifen sehen, sondern etwa auch Alfred Hitchcocks „Die Vögel“. Als er seine Dozentin (Marlen Ulonska) mit dem Rosa-Luxemburg-Wort von der „Freiheit der Andersdenkenden“ herausfordert, fliegt er von der heute nach Konrad Wolf benannten Hochschule, zieht von Zuhause aus und schließt sich der Prenzlberger Literaten-Bohème an.

Thomas ist ein Womanizer, lebt ein Dreiecksverhältnis mit Bettina (Paula Hans) und Sandra (Ioana Iacob), darf Letztere aber nicht in deren rumänische Heimat begleiten. Später komplettieren Sylvia (Emma Bading) und Gerit (Luisa-Céline Gaffron) seinen Harem, bevor er mit Katarina (Berliner Schnauze wie „die“ Thalbach: Jella Haase) ernst macht – sämtlich starke, selbstbewusste Frauen. Mit denen ihn mehr verbindet als Sex: als der „Prager Frühling“ neue Hoffnung auf einen entstalinisierten Kommunismus weckt, startet Thomas mit Sandra die Flugblattaktion „Dubček für die DDR“ im Stil der „Weißen Rose“ um Sophie Scholl. Woraufhin ihn Vater Horst, der den Einmarsch der Nationalen Volksarmee in Prag verteidigt, an die Staatsorgane ausliefert: Zwei Jahre und drei Monate Gefängnis, Isolationshaft im Käfig wie in Guantanamo.
Zur Bewährung in der Produktion vorzeitig entlassen als Fräser im Kabelwerk Oberspree erlebt er, wie eine Dokumentation im DDR-Fernsehen mit vorgegebenen Fragen und Antworten entsteht. Ihn zieht es in jeder freien Minute in die Künstlerszene, am Berliner Ensemble lernt er Katarina kennen – und nun ist es um ihn geschehen. Sandra hat auch noch das Nachsehen, als Katarina von einem anderen Mann schwanger wird: Letzterer hat Thomas sein Stück „Lovely Rita“ auf den Leib geschrieben, was in der Eingangsszene des über volle zweieinhalb Stunden hochspannenden Spielfilms wörtlich genommen werden kann. Der sich, wie es im Wild Bunch Presseheft heißt, an das Leben von Thomas Brasch anlehnt: „Alle Figuren und privaten Geschehnisse sind jedoch fiktional.“
Als der Verlag Neues Leben sein „Poesiealbum 89“ herausbringt, fühlt sich Thomas Brasch endlich als Schriftsteller anerkannt. Nach Problemen mit Stasi-Spitzeln spricht er persönlich mit Erich Honecker (ein Clou: auch Jörg Schüttauf), während sein Vater im Nebenraum mithört. Nachdem die Proben zu „Lovely“ Rita abgebrochen werden mussten, stellen Thomas und Katarina Ausreiseanträge in den Westen. „Sie lassen uns gehen, sollen wir uns freuen?“ bleibt Thomas skeptisch.
West-Berlin, 1976. Medien-Hype, Sektempfang. „Vor den Vätern sterben die Söhne“ erscheint im renommierten Suhrkamp-Verlag (in Wirklichkeit zunächst bei Rotbuch). Katarina freut sich über Theater-Engagements, Thomas bekommt in New York ein hochdotiertes Roman-Angebot samt Appartement-Schlüssel. Doch diese versenkt er im Gully. Cannes, 1981. Bei der Wettbewerbs-Premiere seines Films „Engel aus Eisen“ begegnet Thomas noch einmal seinem Vater. Im Jahr darauf wird ihm von Franz-Josef Strauß der Bayerische Filmpreis überreicht. Thomas sorgt für einen Eklat, als er sich für die – durch staatliche Intervention ja abgebrochene – Ausbildung in Babelsberg bedankt. Eine bewusste Provokation, hat er doch in München auch gesagt: „Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche. Die Widersprüche sind die Hoffnung.“ Berlin, 2001. Thomas Brasch (nun Peter Kremer) bezieht nach dem Fall der Mauer wieder die alte Wohnung am Schiffbauerdamm: „Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.“
„Lieber Thomas“ ist weder ein Biopic noch eine chronologisch-stimmige Biographie der beiden in der DDR aufgewachsenen Filmemacher Thomas Wendrich (Drehbuch) und Andreas Kleinert (Regie). Sondern ein politisches Vater-Sohn-Drama, eine mit Sex, Drugs und Rock’n Roll gepowerte Liebesgeschichte und nicht zuletzt das von Albrecht Schuch ungemein intensiv verkörperte Porträt eines Zerrissenen („Schreiben heißt für mich, öffentlich Angst überwinden oder es zu versuchen.“) der nirgends richtig Zuhause gewesen ist: „Ich stehe für niemand anders als für mich.“ Die bewusst in Schwarz-Weiß und in Braschs Lieblingsformat Cinemascope gedrehte assoziative Annäherung an den Dichter, dessen Stück „Lieber Georg: Ein Eis-Kunst-Läufer-Drama aus dem Vorkrieg“ unter Claus Peymann in Bochum uraufgeführt wurde, kommt am 11. November 2021 in die Kinos, in unserer Region u.a. im Casablanca Bochum sowie im Rio und im Filmstudio Glückauf in Essen.