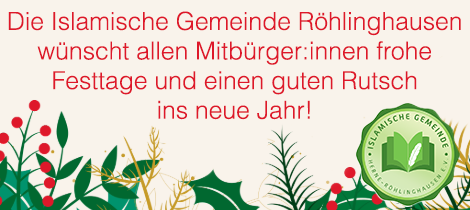Make Schalke Great Again
'Die Dreigroschenoper' am MiR
„Die Welt ist arm, der Mensch ist schlecht“: Dass das Fressen über die Moral siegt, war schon 1728 eine Binse, als Bertolt Brechts Vorlage seines größten Erfolges, „The Beggar’s Opera“ von John Gay und Johann Christoph Pepusch, im Londoner Lincoln’s Inn Fields Theatre uraufgeführt wurde. „Und das ist eben schade, das ist das riesig Fade“: Grundlegend geändert hatten sich die Verhältnisse weder bei Erich Engels Uraufführung der „Dreigroschenoper“ am 31. August 1928 im Berliner Theater am Schiffbauerdamm noch bei der letzten Inszenierung am Gelsenkirchener Musiktheater im Revier durch Michael Schulz, die am 3. Oktober 2009 im Kleinen Haus stürmisch gefeiert wurde.
Wir erinnern uns an Rüdiger Frank als Peachum, an Lars-Oliver Rühl als Macheath, an Judith Jacob als Polly und nicht zuletzt an Joachim G. Maaß als Tiger Brown: Episches Theater in minimalistischer Ausstattung gepaart mit szenischer Drastik und operettenhafter Opulenz ergaben drei so kurzweilige wie kulinarische Stunden. Nun hat sich Michael Schulz vorzeitig ans ungleich besser ausgestattete Saarbrücker Staatstheater verabschiedet, was man ihm schon allein der französischen Küche in der Hauptstadt des kleinsten Flächenlandes unserer Republik wegen nicht verargen darf.
Dass er die Neuinszenierung der „Dreigroschenoper“, die am 26. April 2025 im Großen Haus Premiere feierte, Markus Bothe anvertraute, ließ aufhorchen. Der höchst innovative, allem Neuen gegenüber aufgeschlossene Schauspiel- und Musiktheaterregisseur, der 2010 für seine Frankfurter Kindertheater-Inszenierung „Roter Ritter Parzival“ mit dem deutschen Bühnen-Oscar „Der Faust“ ausgezeichnet worden war, nahm die Puppenspiel-Sparte des MiR mit ins Boot.

Was sollte schiefgehen, war das Stück als „Oper für Schauspieler“ doch selbst ein Experiment, das Kurt Weill in einem Beitrag für die in Wien erscheinende Monatsschrift für moderne Musik, „Anbruch“, als Gründung einer neuen Gattung ansah, die an die Stelle der Operette treten könnte: „Wir kommen mit der ‚Dreigroschenoper‘ an ein Publikum heran, das uns entweder gar nicht kannte oder das uns jedenfalls die Fähigkeit absprach, einen Hörerkreis zu interessieren, der weit über den Rahmen des Musik- und Opernpublikums hinausgeht.“
„Was wir machen wollten“, so Kurt Weill in seinem im Januar 1929 erschienenen Beitrag, „war die Urform der Oper. Bei jedem musikalischen Bühnenwerk taucht von neuem die Frage auf: Wie ist Musik, wie ist vor allem Gesang im Theater überhaupt möglich? Diese Frage wurde hier einmal auf die primitivste Art gelöst. Ich hatte eine realistische Handlung, mußte also die Musik dagegensetzen, da ich ihr jede Möglichkeit einer realistischen Wirkung abspreche. So wurde also die Handlung entweder unterbrochen, um Musik zu machen, oder sie wurde bewußt zu einem Punkt geführt, wo einfach gesungen werden mußte.“
Auch bei Markus Bothe macht der Bettlerkönig Peachum (der 1971 im fränkischen Schwabach geborene Schauspieler Klaus Brömmelmeier) mit seiner resoluten Gattin Celia (Martin Homrich) ein florierendes Geschäft aus dem Mitleid der Menschen. Da er seiner Tochter Polly (die Neu-Kielerin Fayola Schönrock kommt frisch aus der Salzburger Schauspielschule Mozarteum) vergeblich verboten hat, den Gangsterboss Macheath, genannt Mackie Messer (die Puppenspielerin Gloria Iberl-Thieme), zu heiraten, versucht er nun, den ungeliebten Schwiegersohn hinter Gittern zu bringen und erpresst dazu dessen besten Freund, den Londoner Polizeichef Tiger Brown (Sebastian Schiller).
„Es muss etwas Neues geschehen“: Weil aber wenigstens auf den Bühnenbrettern ein heutiger Zeitgeist wehen soll, steckt Klaus Brömmelmeier im leuchtend blauen Anzug, den Donald Trump selbst bei der Papst-Trauerfeier im Vatikan nicht abgelegt hat. Zum dritten Dreigroschen-Finale erscheint zwar der reitende Bote mit der Nachricht von der Begnadigung des Hurenbocks Mackie Messer, die Freude bei „seinen“ Frauen aber, noch zu nennen der Schau- und Puppenspieler Daniel Jeroma als Lucy Brown, hält sich in engen Grenzen. Wer Ruth Berlaus unverblümte Abrechnung mit dem nur scheinbaren Weiberheld B.B. aus dem Jahr 1940, „Jedes Tier kann es“, gelesen hat, weiß warum.
Das mit den Puppen, deren graue Gesichter sämtlich der im Berliner Ensemble zu besichtigenden Maske Bertolt Brechts entsprechen, ist ein Verfremdungseffekt, der sich rasch abnutzt. Eine Leerstelle wie die von vier Scheinwerfern gerahmte Arena Robert Schweers. Dahinter weiß immerhin der abgespeckte Klangkörper der Neuen Philharmonie Westfalen zu überzeugen auf leicht erhöhtem Podium, engagiert geführt vom in Lübeck geborenen Berliner Dirigenten Lutz Rademacher. Was aber weder die inszenatorischen („Make Schalke Great Again“) noch manche gesanglichen Peinlichkeiten aus der Welt schafft.
karten
Karten unter musiktheater-im-revier.de oder unter Tel 0209 - 4097200
Die weiteren Vorstellungen im Großen Haus
- Freitag, 16. Mai 2025, 19:30 Uhr (Im Anschluss Bargespräche)
- Sonntag, 18. Mai 2025, 18 Uhr
- Donnerstag, 29. Mai 2025, 18 Uhr
- Samstag, 7. Juni 2025, 18 Uhr
- Sonntag, 15. Juni 2025, 18 Uhr
- Sonntag, 22. Juni 2025, 18 Uhr
- Freitag, 4. Juli 2025, 19:30 Uhr
Vergangene Termine (7) anzeigen...
- Freitag, 16. Mai 2025, um 19:30 Uhr
- Sonntag, 18. Mai 2025, um 18 Uhr
- Donnerstag, 29. Mai 2025, um 18 Uhr
- Samstag, 7. Juni 2025, um 18 Uhr
- Sonntag, 15. Juni 2025, um 18 Uhr
- Sonntag, 22. Juni 2025, um 18 Uhr
- Freitag, 4. Juli 2025, um 19:30 Uhr